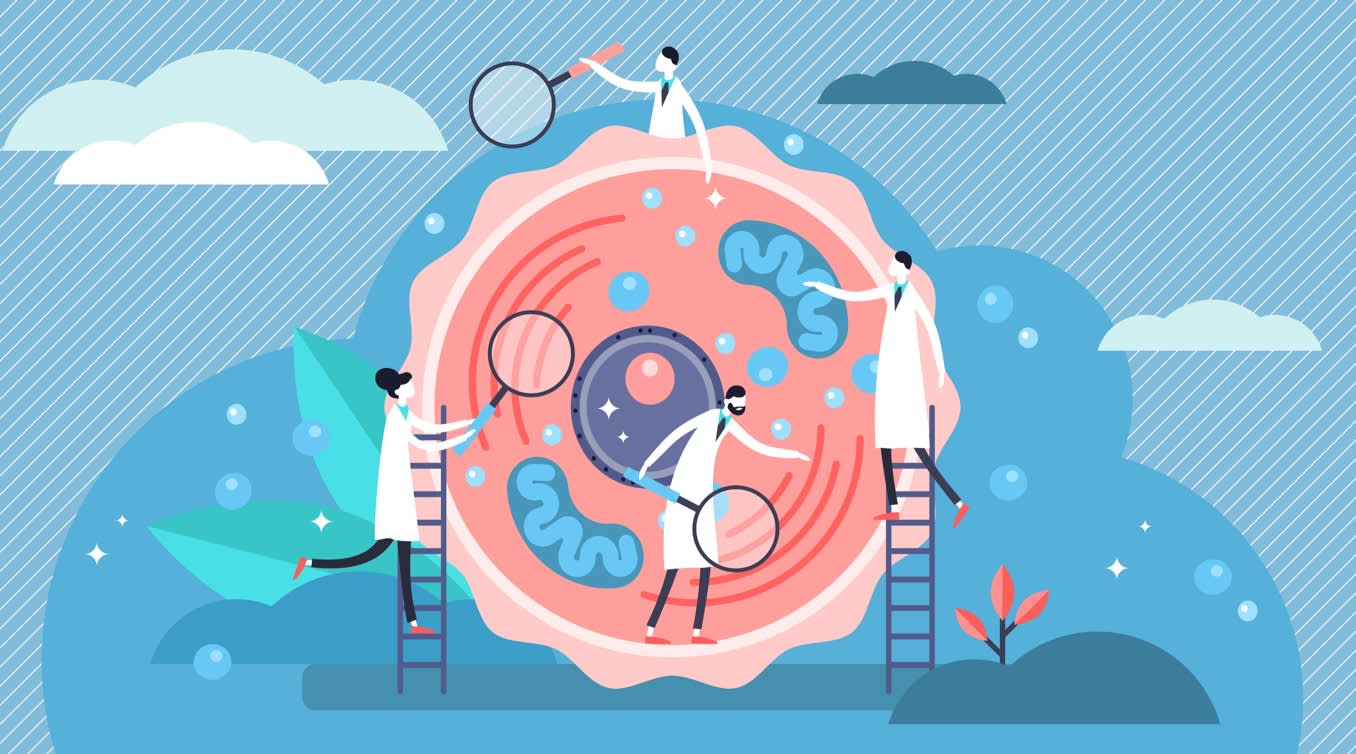„Lasst die Revolution beginnen“ – unter diesem Motto steht die sechste und letzte Staffel der Erfolgsserie The Handmaid’s Tale, deren Finale ab dem 26. Mai auf Magenta TV läuft. Im gleichnamigen Roman von Margaret Atwood, auf dem die Serie basiert, sind solche Kampfparolen nicht zu lesen. Dort ist die Revolution noch in weiter Ferne. Ein Zeichen dafür, wie weit sich die Serie von der Buchvorlage entfernt hat? Wir machen den Check. Im Folgenden erfährst du, warum die Verfilmung trotz erzählerischer Freiheiten bis zum Schluss den Grundideen des Romans treu blieb – und welches Atwood-Buch als nächstes adaptiert wird.
The Handmaid’s Tale: Das Buch und seine Hintergründe
Die kanadische Autorin Margaret Atwood schrieb Der Report der Magd – Originaltitel The Handmaid’s Tale – Anfang der 1980er-Jahre. Als zentrale Inspirationsmomente für das Buch benannte sie ihre damaligen Aufenthalte im geteilten Berlin des Kalten Krieges sowie ihre Auseinandersetzung mit den puritanischen Traditionen in Neuengland.
Endgültiger Auslöser waren allerdings Forderungen nach Verboten jeglicher Form von Geburtenkontrolle, speziell Abtreibungen, die in den Achtzigern von Seiten der politischen Rechten in den USA laut wurden.
„Ich habe The Handmaid’s Tale als Reaktion auf meine eigenen damaligen Fragen geschrieben, was passieren würde, wenn diese Leute an die Macht kämen, und was sie dann tun würden“, schreibt Atwood in ihrem Essay-Band Burning Questions. „Frauen sollten zu Hause bleiben, und die Methode, das zu erreichen, war, sie ihrer Jobs und ihres Geldes zu berauben. Sie sollten den Bedürfnissen der Männer dienen, wie schon Rousseau es gefordert hatte, andernfalls waren sie nichts wert.“
So spielt Der Report der Magd in einer nicht konkret datierten Zukunft. Schauplatz ist ein gnadenloser Überwachungsstaat namens Gilead. Dieser wurde infolge einer atomaren Katastrophe auf einem Teilgebiet der heutigen USA errichtet und ist fest in der Hand eines christlich-fundamentalen Männer-Regimes. Frauen sind dort in Kategorien wie (respektable) „Ehefrauen“, (verstoßene) „Unfrauen“ und „Mägde“ eingeteilt. Letztere dienen den Herrschenden als Hausmädchen und Gebärmaschinen.
Atwoods Roman thematisiert den von Ängsten und Bigotterie geprägten Alltag in Gilead. Das Buch ist buchstäblich als „Report“ angelegt. In tagebuchartigen Kapiteln berichtet die Magd Desfred über ihre Erlebnisse im Haus des Kommandanten Fred. Sie muss Intrigen, Unterdrückung und entwürdigende Begattungs-„Zeremonien“ über sich ergehen lassen, protokolliert aber auch geheime Momente der Hoffnung, des Widerstands und erinnert an ihr freies Leben vor Gilead.
Die Rückblenden in Desfreds Vergangenheit schildern letztlich Alltagsszenen westlicher Demokratien von heute, aber sie gewinnen vor dem Hintergrund der dystopischen Erzählgegenwart große Emotionalität. Sie sind wie eine Mahnung an die Lesenden, erstrittene Werte der Aufklärung und des Liberalismus zu bewahren und zu verteidigen. Dieses Anliegen liegt Margaret Atwoods Schreiben generell zugrunde.
Als Der Report der Magd 1985 erschien, bekam der Roman von der Kritik viel Lob. Er wurde mit verschiedenen Literaturpreisen ausgezeichnet und erhielt im Folgejahr eine Nominierung für den renommierten Booker Prize.
Atwood & Co: Die besten Science-Fiction-Hörbücher, die von Frauen geschrieben wurden
The Handmaid’s Tale: Die Serie und ihre Hintergründe
Im Jahr 1990 wurde Der Report der Magd erstmals verfilmt – mit einem Drehbuch des späteren Literaturnobelpreisträgers Harold Pinter sowie Volker Schlöndorff als Regisseur. Auch Margaret Atwood wirkte im Hintergrund mit, was aber nichts daran änderte, dass der Film bei Publikum und Kritik weitgehend durchfiel. In den Folgejahren gab es mehrere Bearbeitungen des Stoffes für die Bühne – als Theaterstück, als Oper und als Ballett.
2017 startete schließlich die Serienadaption von Bruce Miller. Sie räumte auf Anhieb alle wichtigen US-Filmpreise ab und erhielt als erste Streaming-Produktion einen Emmy Award für die Beste Drama-Serie. Millers Wunschkandidatin für die Hauptrolle war von Anfang an Elisabeth Moss. Sie brillierte als Desfred und erhielt ihrerseits zahlreiche Preise vom Golden Globe bis zum Emmy. Begleitend zur Serie las sie eine neue englische Hörbuchfassung der Romanvorlage ein.
Die erste Staffel von The Handmaid’s Tale blieb nah am Buch und erzählte dessen Handlung mit kleinen Ausschmückungen chronologisch nach. Die drei wichtigsten Änderungen gegenüber der Romanvorlage waren:
Im Buch wird die Hauptfigur nur mit ihrem Gilead-Pseudonym Desfred benannt – ein Kunstname, der sie als „Besitz“ von Kommandant Fred markiert. In der Serie gibt sie auch ihren Rufnamen aus der Prä-Gilead-Ära preis: June.
Technische Entwicklungen, die im Roman auf 1980er-Jahre-Niveau waren, wurden in der Serie auf den aktuellen Stand gebracht. Die Figuren benutzen also zum Beispiel Handys.
Die Erzählebene des Epilogs, der Desfreds „Report“ als historisches Dokument aus dem mittlerweile gescheiterten Staat Gilead einordnet, wurde weggelassen.
Für all diese Änderungen gab Margaret Atwood ihren Segen. Die Autorin war maßgeblich am Entstehungsprozess der Serie beteiligt und hatte in der Pilotfolge sogar einen Cameo-Auftritt. Auch als nach dem großen Erfolg der ersten Staffel eine Fortsetzung und damit eine Weitererzählung der nunmehr ausgeschöpften Romanhandlung zur Debatte stand, gab Atwood grünes Licht. Im Interview für The Art and Making of The Handmaid’s Tale sagt sie über die zweite Staffel:
„Es war toll zu sehen, wie die Serie Andeutungen und Pinselstriche aufgriff... Aber letztendlich ist jede Serie, die auf einem Buch basiert, eine Neuschöpfung und ein eigenständiges Kunstwerk.“
Mit den Andeutungen und Pinselstrichen sind Handlungsstränge gemeint, die im Buch lediglich erwähnt wurden und die die Serie auserzählt – etwa das Geschehen in den Kolonien oder die Schicksale von Junes Mann Luke und ihrer Tochter Hannah. Dieses Prinzip blieb bis zur Abschlussstaffel Programm. So wurden die zentralen Motive und Charaktere aus dem Roman beibehalten. Die Handlung wurde lediglich auf Junes Beteiligung am geheimen Widerstand der Mayday-Bewegung zugespitzt.
Letzterer dürfte im Serienfinale in der oben genannten „Revolution“ münden. Dass bei alledem der Spirit des Romans erhalten blieb, gewährleistete noch ein weiterer Grundsatz, den das Drehbuch-Team von Margaret Atwood übernahm. In einem Essay, den die Autorin 2017 zum Serienstart in der New York Times veröffentlichte, bringt sie ihn folgendermaßen auf den Punkt:
„Eine meiner Regeln war, dass ich keine Vorgänge mit ins Buch nehme, die nicht schon mal passiert sind im – wie James Joyce es einmal bezeichnet hat – ‚Alptraum‘ der Geschichte. Auch keine Technologien, die es noch nicht gab. Keine erfundenen Gadgets, keine erfundenen Gesetze, keine erfundenen Greueltaten. Es heißt, Gott steckt im Detail. Das Gleiche gilt für den Teufel.“
Kurzum: Auch wenn Roman und Serie der Sparte dystopischer Science-Fiction zuzuordnen sind, tragen sie nicht die fantastischen Züge, mit denen das Genre häufig assoziiert wird. Sie fußen auf realen Diktaturen und Kämpfen der Menschheitsgeschichte. Das macht sie erschreckend realistisch und aktuell.
Faszination Dystopie: 10 Hörbücher mit Endzeitszenario, die du kennen solltest
The Handmaid’s Tale: Was Roman und Serie bewirkt haben
Neben den zahlreichen Preisen, die sowohl Buch als auch Serie erhielten, lässt sich die anhaltende Aktualität des The-Handmaid’s-Tale-Stoffes außerdem mit Blick auf aktuelle politische Situationen verdeutlichen. Auch zu diesem Thema hat Margaret Atwood im bereits erwähnten Essay-Band Burning Questions einen eindringlichen Kommentar verfasst.
In dem Kapitel „I invented Gilead, the Supreme Court is making it real“ – auf Deutsch: „Ich habe Gilead erfunden, der Supreme Court lässt es Wirklichkeit werden“ – kommentiert Atwood einen Antrag des erzkonservativen Supreme-Court-Richters Samuel Alito aus dem Jahr 2022. Dieser sprach Frauen unter Berufung auf traditionelle amerikanische Werte das Recht auf Abtreibungen ab. Atwood vergleicht diese Maßnahme einerseits mit den Zuständen in ihrem Roman. Andererseits setzt sie sie in Bezug zu den puritanischen und frauenverachtenden Gesetzen des 17. Jahrhunderts, die Der Report der Magd teilweise inspirierten. Atwood schreibt:
„Das Alito-Gutachten gibt vor, auf der amerikanischen Verfassung zu beruhen. In Wahrheit stützt es sich aber auf die englische Rechtsprechung des 17. Jahrhunderts, eine Zeit, in der der Glaube an Hexerei den Tod vieler unschuldiger Menschen verursachte. (...) Wenn Richter Alito möchte, dass wir nach den Gesetzen des 17. Jahrhunderts regiert werden, sollten wir uns diese Zeit genauer ansehen. Ist das wirklich das Jahrhundert, in dem wir leben wollen?“
Demzufolge liefen bei Protesten gegen das Alito-Urteil einige Menschen mit, die als Zeichen des Widerstands die roten Kutten und weißen Kappen aus der The-Handmaid’s-Tale-Serie trugen. Das Outfit entwickelte sich schon kurz nach dem Start der ersten Staffel zum Symbol feministischer Proteste. Der Grund: Die Serie startete im April 2017, drei Monate nach dem Beginn der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, als in den USA massiv gegen dessen antidemokratische und anti-emanzipatorische Politik demonstriert wurde.
Dass die letzte Handmaid’s Tale-Staffel nun am 8. April 2025 startete, knapp drei Monate nach dem Beginn von Trumps zweiter Präsidentschaft, ist so bitter-ironisch wie sinnbildlich. Denn auch diese Amtszeit begann mit bedenklichen Maßnahmen, die Frauen in überkommene Rollenmuster zurückdrängen sollen – darunter Dekrete gegen „Gender-Ideologie“, Initiativen zum Verbot von Abtreibungen sowie staatliche Geburtenförderung. The Handmaid’s Tale ist also aktuell wie eh und je.
Bücher über weibliche Vorbilder: Diese Aktivistinnen verändern die Welt
The Handmaid’s Tale: Wie es nach dem Serienfinale weitergeht
Wenn am 26. Mai die letzte Handmaid’s Tale-Folge auf Sendung geht, ist das kein endgültiger Abschied von der Welt der Serie. Das Spin-off ist bereits in Arbeit. Im Herbst gab Handmaid-Showrunner Bruce Miller bekannt, dass er und sein Team mitten in der Entwicklungsphase der Adaptierung von Die Zeuginnen stecken, der Fortsetzung von Der Report der Magd, die Margaret Atwood 2019 veröffentlichte.
In Die Zeuginnen kommen statt Desfred unterschiedliche Frauen aus Gilead zu Wort. Eine Schlüsselposition nimmt dabei Tante Lydia ein, die in der Serie von Ann Dowd gespielt wird. Dowds eindrückliche Darstellung der skrupellosen Ausbilderin beeindruckte Atwood so sehr, dass sie zum wichtigen Inspirationsmoment beim Schreiben der Fortsetzung wurde. „Sie ist wunderbar“, so Atwood in The Art and Making of The Handmaid’s Tale. „Am Ende der zweiten Staffel habe ich gesagt ‚Ihr dürft auf keinen Fall Tante Lydia töten‘. Gott sei Dank haben sie es nicht getan.“
Im Herbst können wir uns zudem auf weitere Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Der Report der Magd und Die Zeuginnen freuen. Denn dann bringt Margaret Atwood mit Book of Lives ihre Memoiren heraus. Darin lässt die Autorin die 85 Jahre ihres Lebens Revue passieren und erinnert sich unter anderem an das „Orwell‘sche Berlin der 1980er-Jahre, wo Der Report der Magd entstand“, so die Verlagsankündigung.
Unser Fazit: Nach der Serie ist vor dem Buch, denn nach The Handmaid’s Tale ist vor Die Zeuginnen. Ansonsten genügt wohl ein Blick auf die Weltlage, um die ungebrochene Relevanz von Atwoods Mahnungen, demokratische und liberale Werte zu verteidigen, zu erkennen. Es lohnt sich also, weitere Bücher aus dem reichhaltigen Werk der Autorin zu entdecken.
Dystopisch, historisch, scharfsinnig: Die Romane von Margaret Atwood
The Handmaid’s Tale: Dystopische Romane bei Audible erleben
Margaret Atwood ist in verschiedensten Genres und Textformen zu Hause. Auch bei Audible kannst du Bücher unterschiedlicher Themen und Schwerpunkte erkunden – von klassischer Science-Fiction über historische Romane bis zum Sachbuch. Falls du Audible noch nicht ausprobiert hast: Im Probemonat streamst du unbegrenzt Tausende von Hörbüchern, Hörspielen und Original Podcasts. Zusätzlich erhältst du einen kostenlosen Titel, den du für immer behalten kannst.